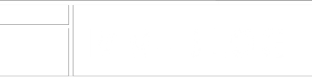Ob sich Peter Sloterdijk bei der Formulierung der in der Überschrift zitierten These nicht so ganz festlegen wollte, kann man nur erahnen, da er konjunktivisch relativiert, dass man diesen Vorgang so bezeichnen „dürfte“, wenn man denn so will.
Wir haben in diversen chorsinfonischen Kompositionen der Heiligen katholischen Messe – zuletzt von Bruckner und Mozart – im GLORIA die Zeilen des Bekenntnisses zur Dreifaltigkeit gesungen:
Quoniam tu solus sanctus, to solus dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe
Cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Amen!
Dabei haben viele von uns sicher nicht zwangsläufig daran gedacht, dass sich diese Trinität erst mit jenem Ereignis komplettiert hat, das wir zu Pfingsten feiern. Ohnehin lässt sich der „Heilige Geist“ im Gegensatz zu den anderen beiden göttlichen Offenbarungen der Dreieinigkeit nicht in eine personelle Vorstellung übersetzen. Er ist für die naive Wahrnehmung an Zeichen gebunden, deren Interpretationshoheit die Kirche zu IHREM fortan bestehenden und die Moral dominierenden Auftrag erhebt.
Das Interview der „Rheinischen Post“ mit dem im „Eyecatcher“-Foto deutlich fingerzeigenden Philosophen Peter Sloterdijk hat in mehreren Passagen meine besondere Aufmerksamkeit gefangen. Zunächst, weil die Überschrift „Das Christentum ist ein gescheitertes Projekt“ eine kulturell abendländisch-christlich geprägte Gesellschaft eigentlich schockieren muss. Selbst wenn sich nunmehr nur noch knapp 50% der Deutschen zur Institution Kirche bekennen, basieren doch die gesamten kulturellen Erfahrungen auf einer Weltanschauung, die sich entweder im Glauben oder im wie auch immer gearteten Zweifel auf Überlieferungen gründet, ohne deren dogmatischen oder aufklärerischen Interpretationen die vergangenen Jahrhunderte im alten Europa kaum denkbar wären. Selbst die atheistischen und besonders die materialistischen Strömungen haben sich weitgehend polemisch gegen den alles prägenden Idealismus gerechtfertigt.
Anlass des Interviews war das Pfingsten, an dessen Charakteristik als Geburtsstunde der Kirche der dieser Institution besonders verbundene RP-Feuilletonchef erinnert. Sein Gast Peter Sloterdijk verweist auf das 50 Tage nach Jesu Auferstehung gefeierte Pfingsten (Pentekosté) als ein in seiner Entstehung erkennbares „Kontrastfest“ zum 7 Wochen nach den jüdischen Pessach-Feierlichkeiten begangenen „Shawuot“, dem Gedenken an die Übergabe der Gesetzestafeln an Moses. Die identischen Fristen zwischen der Befreiung der Israeliten bzw. der Erlösung der Menschen durch Jesus Tod am Kreuz und der jeweils nach 50 Tagen erfolgten Auftragserteilung durch Gott lassen erkennen, dass – so Sloterdijk – im Neuen Testament die „Überschreibung eines jüdischen Festanlasses“ stattfindet.
Vom Pfingstereignis berichtet die Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist in Form feuriger Zungen auf die versammelten Jünger herniederkam und sie plötzlich in der Lage waren, alle Sprachen zu verstehen und zu sprechen, also als Auserwählte und Beauftragte missionarisch mit der Verbreitung und Institutionalisierung des neuen Glaubens zu beginnen, also Kirche wachsen zu lassen.
Mich interessierte dabei besonders die Argumentation zugunsten der universellen Verständlichkeit der Musik, die Sloterdijk in seiner Skepsis gegenüber dem von Lukas überlieferten Fremdsprachenwunder entwickelt:
„Das pfingstliche Geschehen ist gewissermaßen meteorologisch relevant, wie ein Windhauch, der Verständigungen jenseits der verschiedenen Sprachen erlaubt. Ein neuer Konsensus kann sich nur übersprachlich manifestieren. Man könnte die damals aufgebrochene Erfahrung vielleicht mit „gemeinsame Freude“ oder „gemeinsame Erhebung“ übersetzen. Vorsprachliche Hochgefühle eignen sich gut für Gruppenenthusiasmen: sie haben etwas Protomusikalisches. Mit Anspielung auf Nietzsche dürfte man den Vorgang als „die Geburt der Kirche aus dem Geiste der Musik“ bezeichnen, wobei Musik und Kult noch ungetrennt wären. So etwas kann Sprache nicht leisten. Die Sprachen trennen, wie man seit dem Mythos des Turmbaus zu Babel weiß.“
Die universelle Wahrnehmungsvalenz der Musik stellt natürlich keinesfalls eine Garantie auch nur ähnlicher Interpretationen oder einer erfolgreich kanalisierten Verstehbarkeit dar. Aber dem „Kommuniqué“ (der Musik) sind keine objektiv vorhandenen kommunikativen Grenzen (z.B. eine nicht beherrschte Sprache) gesetzt. Man muss auch keine Noten beherrschen, um Musik erleben oder genießen zu können. Sie trägt also die Allgemeinverständlichkeit in sich, die Grundlage einer sehr differenzierten Begreifbarkeit, einer Hinwendung oder Ablehnung sein kann. Aber eine solche will ja auch in Worte und Sätze gefasster Sprache erreichen, allerdings ist dazu immer ein Konsens über das Zeichen- und Lautsystem erforderlich.
Fest davon überzeugt, dass jedem, der sich mit Musik befasst, ein Zitat begegnet ist, das zwar viele „Väter“ hat, aber unabhängig von der umstrittenen Herkunft das Interesse an der wunderbaren Kunst der harmonischen Tonverbindung bestärkt:
„WO DIE SPRACHE AUFHÖRT, FÄNGT DIE MUSIK AN“
In meinem 65 Jahre alten Poesiealbum finde ich es auf der ersten Seite in der Schrift meines Vaters, eines begeisterten Musikers, dem eine Kriegsverletzung die Fähigkeit zur Virtuosität nahm. Er ordnet diese ewige Wahrheit Beethoven zu. Später wurden mir Bach und Wagner als Quelle genannt, auch wenn inzwischen sicher scheint, dass E.T.A Hoffmann diesen Satz überliefert hat und ihn wie folgt fortsetzt: „Das wunderbarste Geheimnis der Tonkunst ist, dass sie da, wo die arme Rede versagt, erst eine unerschöpfliche Quelle der Ausdrucksmittel öffnet“.
Sloterdijk ersetzt in seiner das Interview überschreibenden Kernaussage die von Nietzsche gemeinte „Tragödie“ durch „Kirche“. Er selbst hat ein Nachwort zu einer Ausgabe des 1872 geschriebenen Frühwerks des klassischen deutschen Philosophen: „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ verfasst. Mir käme es trotz der traurigen Gegenwart nicht in den Sinn, die Kirche als Tragödie zu bezeichnen. Aber so wie die „dramatische Gattung der Tragik“ oftmals die Katharsis beim Adressaten anstrebt, also eine „Reinigung“ oder emotionale Befreiung durch das von Gefühlen bestimmte Ausleben innerer Konflikte, so ist auch die Kirche auf das Entstehen, Intensivieren und Sichern einer starken, dauerhaften und emotional gefestigten inneren Bindung der Gläubigen angewiesen. Dabei ist in der Erkenntnis- und Bekenntnisfrage nicht „Wissen“ sondern „Glauben“ das Ziel der durchaus ästhetische und insbesondere theatrale Vorgänge nutzenden Gottesdienste. Viele Pfarrer wissen, dass Musik mehr zu leisten in der Lage ist, als Sprache oder jene zumindest so emotional verstärkt, dass sie die Disposition der „Seelen“ zu erreichen vermag.
Singend spüren auch wir oftmals die Kraft des „Rauschhaften und Mythischen“, der dionysischen Attribute, die Nietzsche der Musik zuschreibt, wobei das nur zwei – in der Schrift vor allem Wagner zugeordnete musische Emotionsimpulse sind. Wir haben davon weit mehr erlebt, als es eine Gefühlsskala darzustellen vermag. Sicher jeder von uns. individuell und unterschiedlich, manchmal auf wundervolle Weise gemeinsam: beglückend und bedrückend, aufmunternd und niederdrückend, aber vor allem in uns lang nachhallend.
Den unerschöpflichen Quellen geistlicher Vokalsinfonik haben wir uns als Konzertchor gern zugewandt: mit Begeisterung und Freude. Mein Freund Udo Kasprowicz verwies auf das Charakteristikum eines Chores, „die protosprachliche Begeisterung durch den Klang mit der sprachlichen Botschaft zu verbinden“. Wir sind uns dessen bewusst, was nicht zuletzt die internen Diskussionen zeigten, die sich um die teilweise brutalen alttestamentarischen Texte in Ferdinand Hillers „Saul“ drehten, die zu singen mancher sich nur schwer überwinden konnte. Aber gerade auch die Auseinandersetzung um das durch die grandiose Musik des wiederentdeckten Oratoriums verstärkte Kriegerische hatte zur Folge, dass wir uns der Verantwortung für die sprachliche Botschaft durch einen das Werk in die Tradition des damals unumstrittenen „ius ad bellum“ einordnenden Kommentar gestellt haben.
Unsere Begeisterung für Chormusik hat durch ihren kirchlichen Ursprung und ihre überwiegend moralisch mahnenden Inhalte vielleicht doch auch viel mit dem pfingstlichen Wunsch nach ästhetisch verstärkter Erreichbarkeit der Menschen zu tun…