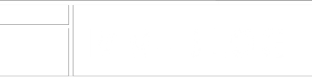„Saul“ als Geschichtsdrama
Das Interesse für ein Thema aus den Geschichtsbüchern des Alten Testamentes geht wohl auf Ferdinand Hiller zurück, der sich dem Judentum geistig eng verbunden fühlte, wenngleich die Familie, aus der er stammte, um äußere Integration in die bürgerliche Gesellschaft bestrebt war. Sein Vater, ein Textilhändler, änderte seinen Namen von Isaac Hildesheimer in Justus Hiller, sei es aus wirtschaftlich pragmatischen Gründen, sei es als Schritt auf dem Weg zu einem modernen deutschen (europäischen?) Judentum. Auch sein Sohn lebte in beiden Welten. Er heiratete eine Sängerin aus polnisch – jüdischem Milieu und wirkte seit 1847 als städtischer Musikdirektor zunächst in Düsseldorf, danach ab 1850 in Köln. Er trat mit seiner Frau in die evangelische Kirche ein und pflegte vertraute Kontakte mit der europäischen Musikwelt, unter sich bekannte Namen wie Schumann und Mendelssohn-Bartholdy, Liszt, Chopin, Brahms, Bruch und Rossini finden. Selbst mit Richard Wagner stand er in vertrautem Briefwechsel.
Die Ausgestaltung des Librettos lag jedoch in dem Händen Moritz Hartmanns, der sich vom Judentum mit 17 Jahren unter dem Druck der judenfeindlichen Atmosphäre des Gymnasiums in Jungbunzlau (Böhmen) losgesagt hatte und – die Überlieferung ist unsicher – entweder als Atheist lebte oder aus pragmatischen Gründen Katholik wurde. Dass er anlässlich seiner Hochzeit einer Konversion zum Protestantismus zustimmte, kann als Beleg für seine liberale, möglicherweise auch gleichgültige Haltung dem Religiösen gegenüber gewertet werden.
Hartmann verlieh der Textvorlage aus der Bibel Züge eines Geschichtsdramas, einer im 19. Jhdt. besonders beliebten Gattung, in der – folgt man Walter Hinck (Germanist in Köln, 1922 – 2015) – vergangene und gegenwärtige Zustände so miteinander verknüpft werden, „dass im Geschichtlichen die Gegenwart zu einem vertieften Verständnis ihrer selbst und zugleich zu einem Ungenügen an sich selbst gelangt, aber auch zu einem Bild oder zur Ahnung möglicher Zukunft. So ist jedem gelungenen Geschichtsdrama ein utopisches Element zu eigen.“
„Saul“ und die Legitimation von Herrschaft
Der Leitbegriff der politischen Diskussion im 19. Jahrhundert war die Legitimation von Herrschaft. Und hier liegt die Verknüpfung des Vergangenen mit dem Gegenwärtigen. Das Bürgertum strebte Partizipation in Form von Wahlen an. Herrschaft soll künftig im Auftrag der Beherrschten ausgeübt werden.
Allein die Tatsache, dass Bürger in der Paulskirche über Form und Größe des zukünftigen Deutschlands entscheiden wollten, zeigt, dass die künftige Führungselite, sei es Kaiser oder Staatspräsident, nicht mehr eigenmächtig handeln und sich zur Rechtfertigung auf Tradition, historische Verdienste oder Gottesgnadentum berufen konnte.
Unbeeindruckt davon taten im dänischen Krieg von 1849 die alten Kräfte, was sie wollten, und besiegelten damit das Schicksal der ersten deutschen Volksvertretung, in deren Reihen auch Moritz Hartmann saß. Er zählte zu den radikalen Demokraten und setzte sich als einer der wenigen österreichischen Sozialisten für eine großdeutsche Republik ein.
Das Oratorium wurde 1858 uraufgeführt. Eine vom Volk legitimierte Herrschaft gab es in Deutschland nach wie vor nicht. Preußen hielt an seinen Plänen eines kleindeutschen Reiches unter seiner Führung fest. Gleichwohl zeigt aber die Vereinbarung zwischen Österreich und Preußen, über Schleswig – Holstein, das nach den dänischen Kriegen endgültig zu Deutschland gehörte, gemeinsam zu herrschen, dass die Würfel noch nicht gefallen waren. Die Spannungen waren groß und betrafen das „Volk“, ohne das „Volkes Stimme“ gehört wurde.
Sie entluden sich 1865 im „Deutschen Krieg“ Preußens und seiner Verbündeten gegen Österreich, in dessen Folge Österreich aus Deutschland ausschied und der Weg zu einer preußisch geführten Reichseinigung geebnet war.
Damit ist Hartmanns „Saul“ ein politisches Gleichnis, das unverfänglich im religiösen Gewand daherkommt, die Revolution von 1848 aber als Zeitenwende sieht, als die sie sich letztlich nicht erwiesen hat.
Eine Antwort darauf, ob Hartmann und Hiller der „ewige Friede“, eine Vision, die an markanten historischen Wendemarken immer wieder beschworen wird (zuletzt 1989!) vor Augen stand, gibt das Oratorium nicht. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Inhalt und dem Zeitgeist, den es atmet, hilft uns jedenfalls, die Maximen dazu zu gewinnen.